Dipl.-Ing.
Ernst Asten
Leiter des Hoch- und
Tiefbauamtes des Landkreises Köthen
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Weingart
Hochschule Anhalt (FH), FB
Architektur und Bauingenieurwesen, Dessau
Wirtschaftliche
Erneuerung
von
Kommunal- und Kreisstraßen
Auf der 10. Gesamtmitgliederversammlung der VSVI Sachsen-Anhalt am 16.06.2000 forderte der Minister für Wohnungswesen, Städtebau und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt Dr. Jürgen Heyer die Mitglieder der Ingenieurvereinigung auf, sich im Interesse der Kostenreduzierung für einen „schlanken Straßenbau“ zu engagieren.
Nachfolgend werden
allgemeine Grundsätze für die wirtschaftliche Straßenerneuerung und
mehrjährige Erfahrungen mit „schlankem Straßenbau“ im Rahmen der Erneuerung von
Kommunal- und Kreisstraßen im Landkreis Köthen dargelegt.
1. Allgemeine Grundsätze für eine
wirtschaftliche Straßenerneuerung
Bei der Anpassung
des flächenerschließenden Straßennetzes, das mehr als 75% des gesamten Straßennetzes beträgt, an die
seit 1990 sprunghaft gestiegene Verkehrsbelastung in den neuen Bundesländern
besteht ein sehr großer Bedarf zur wirtschaftlichen Straßenerneuerung.
Es ist auf Grund
der in den Haushalten der Landkreise und Kommunen nur in begrenztem Umfang zur
Verfügung stehenden finanziellen Mittel jedoch nicht möglich, das gesamte
Straßennetz der Kommunal- und Kreisstraßen in möglichst kurzer Zeit in herkömmlicher
Weise grundhaft zu erneuern.
Deshalb sind
unter Ausschöpfung aller Möglichkeiten des geltenden Regelwerkes grundsätzlich
Variantenuntersuchungen mit dem Ziel durchzuführen, die jeweils wirtschaftlichste
und umweltschonendste Erneuerungsvariante zu ermitteln.
Mit der gewählten
Erneuerungsvariante ist in der Regel mindestens die gleiche Nutzungsdauer und
Tragfähigkeit der erneuerten Straße zu gewährleisten, wie bei dem herkömmlichen
grundhaften Ausbau.
Nur in
Ausnahmefällen sollte auf den sogenannten Zwischenausbau orientiert werden, bei
dem von einer kürzeren Nutzungsdauer ausgegangen wird.
Eine
kostengünstige Universallösung, die für jede Straßenerneuerung
angewendet werden kann, gibt es jedoch nicht.
Es muss in jedem
Einzelfall nach ausreichender Diagnose des Straßenzustandes die günstigste
Erneuerungsvariante unter Berücksichtigung folgender Schwerpunkte ermittelt
werden:
1.1 Untersuchung der vorhandenen
Straßenbefestigung und Bewertung hinsichtlich ihrer Verwendbarkeit als
Tragschicht oder nach entsprechender Aufbereitung als Recyclingbaustoff für die
Herstellung der neuen Befestigung
1.2 Anwendung des Hocheinbauverfahrens unter
Ausnutzung der Resttragfähigkeit der vorhandenen Straße:
Beispielsweise war für die Erneuerung der in Bild 1 dargestellten
Wohnstraße, die viele Schlaglöcher aber keine Spurrinnen aufweist, grundhafter
Ausbau vorgesehen. Untersuchungen über andere Erneuerungsvarianten lagen
nicht vor. Die Anlieger vertraten jedoch den Standpunkt, dass dieser grundhafte
Ausbau nicht erforderlich und zu teuer sei.

Bild 1: Wohnstraße mit ungebundener Trag- und Deckschicht
Nachträglich durchgeführte Tragfähigkeitsmessungen mit dem Plattendruckgerät
ergaben, dass eine hohe Resttragfähigkeit vorhanden ist und die ungebundene
Befestigung nicht ausgebaut werden muss, sondern als Tragschicht genutzt werden
kann, wodurch erhebliche Kosteneinsparungen möglich sind.
1.3 Anwendung des Hocheinbauverfahrens unter
Berücksichtigung der Dickenbemessung von Leykauf:

Bild 2: Kreisstraße mit Schottertragschicht und dünner Asphaltdecke
Bild 2 zeigt eine sanierungsbedürftige Kreisstraße, die gemäß RStO-E im
Hocheinbau erneuert werden kann.
Da keine Spurrinnen vorhanden sind, kann auf die Durchführung von Fräsarbeiten
verzichtet werden.
In diesem Fall ist zur Optimierung der Überbauungsdicke die Anwendung des
Bemessungsverfahrens nach Leykauf (siehe Straße und Autobahn 7/98) zu
empfehlen. Bei diesem Verfahren kann die erforderliche Asphaltverstärkungsschicht
auf der Grundlage der für jede Bauklasse zulässigen Einsenkung nach
Tabelle 1 und der mit Benkelmanbalken gemessenen Einsenkung aus Bild 3
ermittelt werden.
Tabelle 1: Zulässige Einsenkungen mit dem Benkelman-Balken
Bauklasse Leykauf RStO 2000 (Entwurf Sept.
99)
auf
ToB auf HGT
SV 0,28
mm 0,22 mm
I 0,33
mm 0,31 mm 0,23 mm
II 0,36
mm 0,34 mm 0,25 mm
III 0,41
mm 0,37 mm 0,28 mm
IV 0,48
mm 0,43 mm 0,32 mm
V 0,57
mm 0,51 mm 0,35 mm
VI 0,72
mm 0,63 mm 0,38 mm
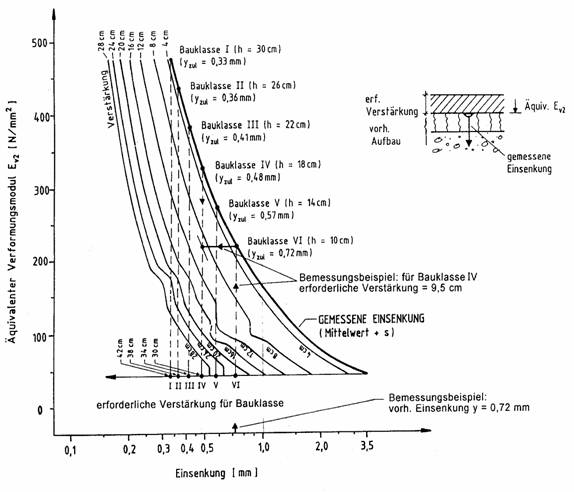
Bild 3: Bemessungsdiagramm für eine Verstärkung in Abhängigkeit von der mit
Benkelman-Balken gemessenen Einsenkung nach Leykauf
1.4 Hocheinbauverfahren bei
Anwendung des Kaltrecycling in situ:
Bei Straßen mit ausgeprägten Tragfähigkeitsschäden (Bild 4) kann es
wirtschaftlicher sein, das Kaltrecyclingverfahren nach Bild 5 und 6 anzuwenden,
bei dem die vorhandene Straßenbefestigung vor Ort aufgearbeitet wird.

Bild 4: Ausgeprägte Tragfähigkeitsschäden auf einer Schotterstraße mit dünner
Asphaltdecke
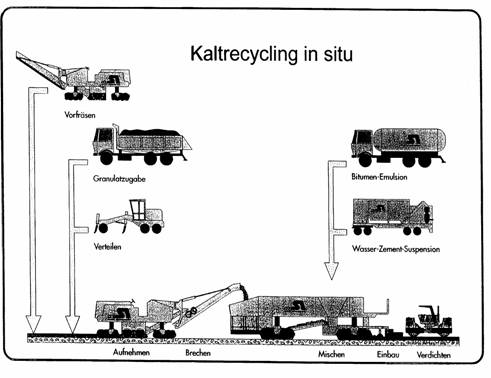
Bild 5: Prinzip des Kaltrecyclingverfahrens nach SAT

Bild 6: Kaltrecyclingtechnik
1.5 Anwendung des kombinierten Hoch- und Tiefeinbauverfahrens unter
Berücksichtigung der „Köthener Bauweise“:
Wenn eine Straßenerneuerung im Hocheinbauverfahren infolge von Höhenzwangspunkten
nicht möglich ist, kann die Erneuerung nach RStO-E im kombinierten Hoch- und
Tiefeinbauverfahren erfolgen. Hierbei wird die alte Straßenbefestigung nicht
vollständig, sondern nur teilweise entfernt und die restliche Trag- oder
Frostschutzschicht mit der neuen Befestigung überbaut.
Dieses kombinierte Hoch- und Tiefeinbauverfahren stellt vor allem bei
kommunalen Straßen eine sehr wirtschaftliche Erneuerungsvariante dar.
Bei sehr geringer Tragfähigkeit der in der Straße verbleibenden Trag- oder
Frostschutzschicht muss jedoch die Überbauungsdicke relativ groß sein, so dass
bei solchen ungünstigen Bedingungen kein wesentlicher Unterschied zum grundhaften
Ausbau im Tiefeinbauverfahren besteht.
Ein wirtschaftlicher Effekt lässt sich allerdings auch in diesen Fällen noch
erzielen, wenn die Tragfähigkeit der verbleibenden Trag- oder Frostschutzschicht
durch ein geeignetes Verfestigungsverfahren dauerhaft erhöht wird. In der Regel
eignet sich hierfür am besten eine Verfestigung mit hydraulischen Bindemitteln.
Zur Vermeidung von Reflexionsrissen in der neuen Asphaltüberbauung ist
anschließend der Einbau einer speziellen Schottertragschicht mit einem
Größtkorn von 22 mm und einem CBR-Wert von mindestens 120 % zweckmäßig.
Die Dicke der neuen Asphaltüberbauung entspricht in der Regel den in RStO angegebenen Schichtdicken auf
Schottertragschichten.
Diese Bauweise wurde im Landkreis Köthen in der Praxis erfolgreich angewendet
und deshalb als „Köthener Bauweise“ bezeichnet.
Nachfolgendes Beispiel zeigt die Anwendung dieser „Köthener Bauweise“ bei
der Erneuerung einer alten
Straßenbefestigung, die sowohl geschädigte Pflastersteine als auch
Tragfähigkeitsschäden aufwies (siehe Bild 7).

Bild 7: Alte Straßenbefestigung mit geschädigtem Großpflaster auf einer
Kiessandtragschicht
Bei der ursprünglich durchgeführten grundhaften Erneuerung dieser Pflasterbefestigung
im Tiefeinbauverfahren wurde festgestellt, dass das Planum nicht die
erforderliche Tragfähigkeit von Ev2 ³ 45 MN/m² aufwies. Aus diesem Grund war zusätzlich erheblicher Bodenaustausch
erforderlich.
Als wirtschaftlichere Erneuerungsvariante erwies sich in diesem Fall die
„Köthener Bauweise“, bei der nur das schadhafte Großpflaster und die alte
Pflasterbettung entfernt wurden. Außerdem wurde nicht die gesamte
Kiessandtragschicht ausgebaut, sondern nur so viel abgetragen, um nach dem
Einbau der neuen Pflasterbefestigung die geplante ursprüngliche Höhe der Gradiente
wieder zu erreichen.
Die restliche verbleibende Kiessandtragschicht wurde mit Zement verfestigt.
Anschließend erfolgte der Einbau eines Splitt-Brechsand-Natursand-Gemisches
0/22 mm mit einem CBR-Wert von 120 % zum Profilausgleich sowie der neuen Pflasterbefestigung.
Auf diese Weise wurden nicht nur Kosten gespart, sondern auch die
Witterungsabhängigkeit verringert und die Bauzeit verkürzt.
1.6 Entwicklung und Erprobung von kostengünstigen Straßen- und Wegebefestigungen
unter Berücksichtigung der Verwendung von Recyclingbaustoffen:
In der Bundesrepublik Deutschland wurden im Jahre 1997 ca. 50 Mio. t Recyclingbaustoffe
hergestellt. Zu diesem Zweck wurden von der Recycling-Industrie in Deutschland
über 25 Mrd. DM neu investiert und 20000 Arbeitsplätze neu geschaffen. Das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen hat daher mit Schreiben vom 16.4.1999 an die ARGEBAU-Minister
auf die Bedeutung der Recycling-Industrie hingewiesen und den Beschluss der 96.
Ministerkonferenz dargelegt, wonach zur Umsetzung des Kreislaufwirtschafts-
und Abfallgesetzes Recyclingbaustoffe vermehrt einzusetzen und bei Normung und
Zulassung nachdrücklich zu berücksichtigen sind.
Bei der „Köthener Bauweise“ können derartige Recyclingbaustoffe z. B. zur
Kornverbesserung der in der Straße verbleibenden Tragschichtmaterialien oder
als Zuschlagstoff für die Verfestigung verwendet werden.
2. Erfahrungen im
Landkreis Köthen
Im
Landkreis Köthen umfasst das Kreisstraßennetz eine Länge von insgesamt
ca. 175 km (siehe Bild 8).
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
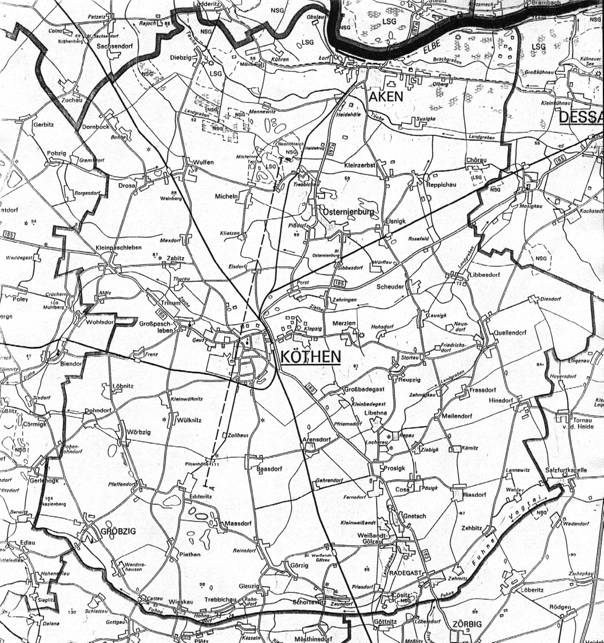
![]()
![]() Bild 8: Landkreis Köthen mit
Straßenerneuerungsmaßnahmen im
Bild 8: Landkreis Köthen mit
Straßenerneuerungsmaßnahmen im
kombinierten Hoch- und Tiefeinbauverfahren nach der “Köthener Bauweise“
Hocheinbauverfahren nach Leykauf
Bei der auf diesem Kreisstraßennetz
anzutreffenden Straßenbefestigung handelt es sich sehr häufig um 4 m bis
4,5 m breite Großpflasterbefestigungen mit 2 m bis 2,5 m breitem
teilweise befestigtem „Sommerweg“ (siehe Bild 9).
Unter dem Pflaster befindet
sich meist eine 20 bis 30 cm dicke Kiessandschicht.

Bild 9: Typische
Großpflasterbefestigung einer Kreisstraße im Landkreis Köthen
Der Untergrund besteht im
westlichen Teil des Kreises aus Löß. Im östlichen Teil geht dieser Boden in
pleistozäne Sande mit unterschiedlich hohen Anteilen an Schluff über.
Der Grundwasserspiegel liegt
in der Regel tiefer als 3 m unter der Straßenoberfläche.
Die Befestigungen sind etwa
80 bis 90 Jahre alt. Den Anforderungen des jetzigen Verkehrs genügen sie nicht
mehr.
Daneben existieren noch
einige Betonstraßen neueren Datums und einzelne Schotterstraßen mit dünnen
Asphaltdecken. Auch der Zustand dieser Befestigungen ist ungenügend.
Nach 1990 wurde mit der
Straßenerneuerung des Kreisstraßennetzes begonnen. Dabei wurde in den ersten
Jahren meist der grundhafte Ausbau nach RStO ausgeführt.
Die Kosten für diese
Straßenerneuerung im Tiefeinbauverfahren lagen im Durchschnitt in der
Größenordnung von 90 bis 120 DM/m². Sehr bald stellte sich
heraus, dass infolge des großen Finanzbedarfs der Ausbau des Gesamtnetzes auf
diese Weise in absehbarer Zeit nicht realisierbar ist.
Um den berechtigten Wünschen
und Forderungen der Bürger im Landkreis nachzukommen, waren auf der Grundlage
der RStO-E wirtschaftlichere Erneuerungsvarianten zu entwickeln.
Grundsätzlich wurde hierbei
der vorhandene Straßenzustand messtechnisch erfasst und die erforderliche Dicke
der neuen Straßenbefestigung an die jeweilige Verkehrsbelastung angepasst.
Da die auszubauenden Straßen
bereits viele Jahrzehnte unter Verkehr liegen, Schwachstellen sich also bereits
vor längerer Zeit gezeigt haben und beseitigt wurden, konnte in der Regel auf
umfangreichere Baugrunduntersuchungen – wie sie für den Neubau notwendig sind - weitgehend verzichtet werden.
Die Voruntersuchungen
wurden auf folgende Aufgaben konzentriert:
·
Messung der
Tragfähigkeit der vorhandenen Befestigung
·
Ermittlung des
Aufbaus der vorhandenen Befestigung nach Art und Dicke der einzelnen Schichten
·
Messung der
Tragfähigkeit der Schichten unter der Decke und des anstehenden Bodens
·
Ermittlung der
Materialkennwerte der vorhandenen Baustoffe und des Untergrundes
·
Durchführung von
Eignungsprüfungen für Verfestigungen, sofern sich der Einsatz solcher Verfahren
aus den ökonomischen Untersuchungen als zweckmäßig erweist.
Auf der Grundlage dieser
Untersuchungsergebnisse wurde durch Variantenvergleich die in jedem Einzelfall
wirtschaftlichste Erneuerungsvariante ermittelt.
Art und Umfang der
Untersuchungen wurden vertraglich gebunden.
Wertmäßig entfielen hierauf
bei einer Maßnahme von 1,5 bis 2,0 km Länge je nach
Schwierigkeitsgrad der zu untersuchenden Trasse etwa
5.000,- bis 10.000,- DM.
Im Landkreis Köthen ergaben
sich im Wesentlichen folgende Ausführungsvarianten für die Straßenerneuerung:
2.1 Asphaltüberbauung der
alten Pflasterbefestigung nach vorheriger Schichtdickenbemessung entsprechend
dem Verfahren „Leykauf“ unter Berücksichtigung der notwendigen Zusatzmassen für
den Profilausgleich sowie die eventuell erforderliche Straßenverbreiterung

Bild 10: Erneuerung einer kommunalen Straße
im Hocheinbau nach entsprechender
Bemessung der neuen Asphaltschichtdicke (OL Wieskau)
2.2 Erneuerung alter
Pflasterbefestigungen nach der „Köthener Bauweise“, wobei das alte Pflaster
ausgebaut und die vorhandene Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln
verfestigt wurde, bevor die neue Asphaltbefestigung auf einer
Schotterzwischenschicht eingebaut wurde.
Für jede Erneuerungsvariante
wurden die Baukosten errechnet und die kostengünstigste Variante ausgeführt.

Bild 11: Beispiel der Straßenerneuerung
einer alten Pflasterbefestigung nach der „Köthener Bauweise“ mit neuer
Asphaltdecke (K 2075 Baasdorf – Arensdorf)
2.3 Bei Zementbetondecken
wurde im Allgemeinen auf Tragfähigkeitsmessungen verzichtet. Die Platten wurden
entspannt und mit 8 bis 12 cm Asphalt überbaut. Erfahrungsgemäß
genügen solche Maßnahmen, um Kreisstraßen den Verkehrsanforderungen für eine
lange Zeit anzupassen.
2.4 Die im Landkreis Köthen
vorhandenen wenigen Schotterstraßen verfügen bereits über eine bituminöse
Verschleißschicht, wie Oberflächenbehandlung, Mischsplittbelag oder
Tränkdecke. Nach Einsenkungsmessungen wurde die Dicke der erforderlichen
Asphaltverstärkung nach Leykauf berechnet.
Die neue Vorgehensweise bei
der wirtschaftlichen Straßenerneuerung ermöglichte es, innerhalb kurzer Zeit
folgende Bauleistungen im Kreisstraßennetz zu realisieren:
14,7 km Pflaster überbauen (Var.
2.1)
24,3 km Pflaster ausbauen und hydraulische
Verfestigung (Var. 2.2)
6,2 km Beton
überbauen (Var.
2.3)
3,6 km Schotter
überbauen (Var.
2.4)
Der Anteil dieser neuen
Verfahren an den gesamten Bauleistungen nahm seit 1996 ständig zu. Ab 1998
wurden alle Maßnahmen nach diesen Prinzipien der wirtschaftlichen
Straßenerneuerung ausgeführt.
Besonders hervorzuheben ist,
dass ab 1997 auch für alle Ortslagen die „Köthener Bauweise“ angewendet wurde
(siehe Bild 12).

Bild 12: Beispiel der Erneuerung einer
kommunalen Straße nach der „Köthener Bauweise“ – Verfestigung der alten
Kiessandtragschicht mit Zement im Mixed-in-place-Verfahren (OL Köthen,
Krähenbergstraße)
Ferner werden aus Mitteln
des Kreises jährlich fünf Baumaßnahmen (Tab. 2) messtechnisch kontrolliert. Es
handelt sich bei diesen Messstrecken ursprünglich um alte Großpflasterbefestigungen
nach Bild 9 auf 25 bis 30 cm dicker Kiessandtragschicht der Bauklasse
IV. Die Bauvorhaben 1, 2, 3 und 5 wurden in „Köthener Bauweise“, das
Bauvorhaben 4 in herkömmlicher Weise grundhaft erneuert.
Tabelle 2: Übersicht über
die Messstrecken
|
Nr. |
Bauvorhaben |
Baujahr |
Neue Befestigung |
Länge |
Fläche |
|
1 |
K 2072 Cattau – Wieskau (OL und freie Strecke) |
1996 |
SMA 0/11 S ATS 0/32 Verfestigung *) |
1366 m |
8196 m² |
|
2 |
K 2075 Baasdorf – Arensdorf (freie Strecke) |
1997 |
Asphaltbeton 0/11 S ATS 0/32 STS 0/22 Verfestigung *) |
1534 m |
9204 m² |
|
3 |
K 2091 Drosa – Wulfen (OL und freie Strecke) |
1997 |
SMA 0/11 S ATS 0/32 STS 0/22 Verfestigung *) |
|
|
|
4 |
Grundhafter Ausbau OL Elsnigk Osternienburger Straße (Ortslage) |
1997 |
SMA 0/11 S ATS 0/32 STS 0/32 Frostschutzschicht |
253 m |
1519 m² |
|
5 |
K 2077 Meilendorf – Ziebigk (freie Strecke) |
1999 |
SMA 0/11 S ATS 0/32 **) STS 0/22 Verfestigung *) |
1237 m |
7478 m² |
*) Verfestigung mit hydraulischen Bindemitteln der alten Kiessandtragschicht, z. T. nach Kornverbesserung
**) Asphalttragschichtdicke gegenüber RStO um 2 cm verringert
Auf diesen Messstrecken wird
jährlich nach dem Frostaufgang die Einsenkung mit dem Benkelman-Balken
gemessen. Die Messungen erfolgen im Abstand von 100 m auf beiden
Fahrbahnseiten. Eine Ausnahme bildet Objekt 4, hier verkürzt sich der
Messabstand auf 50 m.
Die Messergebnisse sind
Tabelle 3 zu entnehmen.
Tabelle 3: Zusammenstellung der Einsenkungsmessungen mit dem Benkelman-Balken
|
Mess- termin |
Februar 1997 |
März 1998 |
März 1999 |
März 2000 |
April 2001 |
|
BV -Nr. |
Bemessungseinsenkung wB [mm] = 10 %
Quantil nach ZTVE |
||||
|
1 |
wB = 0,22 |
wB = 0,13 |
wB = 0,20 |
wB = 0,11 |
wB = 0,15 |
|
2 |
- |
wB = 0,11 |
wB = 0,16 |
wB = 0,12 |
wB = 0,17 |
|
3 |
- |
wB = 0,33 |
wB = 0,24 |
wB = 0,18 |
|
|
4 |
- |
wB = 0,50 |
wB = 0,38 |
wB = 0,42 |
wB = 0,50 |
|
5 |
- |
- |
- |
wB = 0,30 |
wB = 0,22 |
Die Gegenüberstellung der
Einsenkungen in Tabelle 3 zeigt generell, dass bei allen Varianten, die nach
der „Köthener Bauweise“ erneuert wurden, die nach Leykauf für die Bauklasse IV
maximal zulässige Einsenkung von 0,48 mm deutlich unterschritten wird.
Die auf diese Weise
sanierten Straßen besitzen erhebliche Tragfähigkeitsreserven, da die
gemessenen Einsenkungen auch noch unter dem für die Bauklasse SV geltenden
maximal zulässigen Einsenkungswert von 0,33 mm (Leykauf) bzw. 0,22 mm
(RStO 2000 auf HGT) liegen.
Dies gilt im Wesentlichen
auch für das Bauvorhaben 5, bei dem die Asphaltragschichtdicke gegenüber RStO
um 2 cm reduziert wurde.
Im Gegensatz hierzu liegt
die Einsenkung des nach RStO grundhaft erneuerten Bauvorhabens 4 zwischen wB
= 0,38 mm und wB = 0,42 mm. Sie erfüllt damit die für die
Bauklasse IV geltende Anforderung von wB = 0,48 mm.
Größere Tragfähigkeitsreserven
sind bei dieser Erneuerungsvariante aber nicht vorhanden. Bei der ersten
Frühjahrsmessung im März 1998 wurde der maximal zulässige Grenzwert sogar
geringfügig überschritten.
Diese Unterschiede zwischen den Einsenkungen beider Bauverfahren wurden auch auf folgenden anderen Bauvorhaben festgestellt:
·
Industrieverbindungsstraße
Wolfen-Jessnitz-Greppin
„Köthener Bauweise“ wB
= 0,21 mm
klassische Bauweise wB
= 0,43 mm
·
K 2073, OL
Reinsdorf – „Köthener Bauweise“ wB
= 0,26 mm
K 2073, OL Görzig – klassische Bauweise wB
= 0,50 mm
3.
Zusammenfassung
Durch die gute
Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Planungsbüro, bauausführenden
Unternehmen und Hochschule Anhalt konnten im Landkreis Köthen technische
Lösungen entwickelt werden, die die Durchführung wirtschaftlicher
Straßenerneuerungen zur Erzielung eines hohen Gebrauchswertes ermöglichen.
Die Kosten der
Straßenerneuerung nach der „Köthener Bauweise“ liegen wesentlich unter denen
der nach RStO-E im Tiefeinbau mit Tragschichten ohne Bindemittel durchgeführten
Erneuerungsmaßnahmen, wie aus Tabelle 4 ersichtlich ist.
Tabelle 4: Kostengegenüberstellung
|
Bauvorhaben Nr. |
Baukosten |
Einsparungen gegenüber Bauvorhaben 4 |
|
1 |
42,68 DM/m² |
58,51 DM/m² |
|
2 |
43,26 DM/m² |
57,93 DM/m² |
|
4 |
101,19 DM/m² ***) |
- |
|
5 |
44,95 DM/m² |
56,24 DM/m² |
***) ohne Kosten für Entwässerung und Gehwege
Bei der „Köthener
Bauweise“ bewegen sich die Kosten für die Voruntersuchungen in der Höhe der
Kosten für die sonst erforderlichen Baugrunduntersuchungen, die Gesamtkosten
verringern sich jedoch infolge Verkürzung der Bauzeit, Verringerung der
Witterungsabhängigkeit, Einsparung von Erdarbeiten und Materialkosten sowie
Verminderung von Massentransporten.
Dabei kann der ökonomische
Effekt nicht allein in der Senkung der Herstellungskosten und der Bauzeit
gesehen werden. Es kann auf Grund der höheren Tragfähigkeit und der damit
verbundenen geringeren Biegebeanspruchung der Asphaltbefestigung auch eine Verlängerung der Nutzungsdauer
erwartet werden.